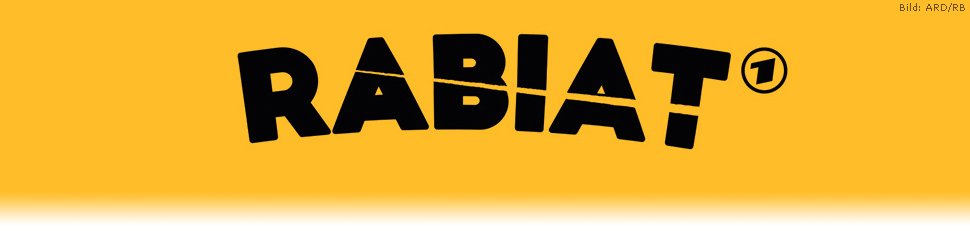Staffel 9, Folge 1–11
Staffel 9 von „Rabiat“ startete am 06.12.2022 in der ARD Mediathek und am 08.12.2022 im SWR.
31. Putins Krieg – Ist das noch mein Russland?
Staffel 9, Folge 1Die „Rabiat“-Autorin Natalia Konyashina lebt seit 25 Jahren in Deutschland. Und wollte eigentlich, dass ihre kleine Tochter neben dem deutschen auch den russischen Pass bekommt. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zweifelt sie jedoch daran, ob das eine gute Idee ist. Natalia unternimmt eine Deutschlandreise zu anderen Menschen, die Russland verbunden sind – oder es waren. Wer will jetzt noch freiwillig russisch sein? Wie geht es anderen Menschen mit ähnlichem postsowjetischen Hintergrund in Deutschland? Wie können manche von ihnen Putins Krieg gutheißen? Was unternehmen wiederum andere, um ihren Protest gegen den Krieg auszudrücken? Und wie kommen Menschen aus Russland und der Ukraine untereinander klar? „Ich liebe Putin“, das sagt eine 42-jährige Spätaussiedlerin aus Hessen ganz offen.
Die Friseurin, die ebenfalls Natalia heißt, ist Ende der 1990er-Jahre aus dem sibirischen Omsk nach Deutschland gekommen. Seit der russische Präsident Wladimir Putin an der Macht ist, könne sie wieder stolz auf ihr Heimatland sein, sagt sie. Als sie mit fast 18 Jahren nach Deutschland gekommen sei, habe sie sich für Russland unter dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin geschämt.
In den Nachrichten im Westen sei er immer betrunken und lächerlich gezeigt worden. Doch hinter Putin stehe sie – auch jetzt. Das kann der 20-jährige Maksim nicht nachvollziehen. Er ist kurz nach dem Ausbruch des Kriegs aus Russland nach Deutschland geflohen. Gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer zu kämpfen, war für ihn schon damals unvorstellbar. „Lieber würde ich ins Gefängnis gehen“, sagt er. Inzwischen arbeitet er in Deutschland als Model, hat eine Aufenthaltserlaubnis – aber nur unter der Voraussetzung, dass er seinen Lebensunterhalt selbst verdient.
Doch angesichts des Kriegs fällt es ihm nicht leicht, vor der Linse immer gut drauf zu sein. Alexander Grüner ist 1998, mit 17 Jahren, aus Russland nach Deutschland gekommen. Zusammen mit seinen Eltern, drei Geschwistern und etwa einem Dutzend weiterer Verwandter landete er praktisch über Nacht in der Metropole Berlin. Der Start war nicht einfach, aber er wollte die Erinnerung an die russische Kultur aufrechterhalten – mit einer Bar. Inzwischen treten in der eigentlich russischen Bar vorwiegend ukrainische Künstlerinnen und Künstler auf.
Die Hälfte der Einnahmen spendet Grüner an ukrainische Hilfsorganisationen. Er unterstützt ukrainische Geflüchtete auch privat. Wladimir Kaminer gilt als einer der bekanntesten Russen in Deutschland und setzt sich seit Jahren für eine Annäherung zwischen Russland und Deutschland ein. Im Film räumt er ein: „Ich schäme mich für mich, dass ich das nicht gesehen habe.“ Autorin Natalia Konyashina sammelt auf ihrer Reise Argumente für und gegen den russischen Pass. Welche Entscheidung wird sie am Ende treffen? (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do 08.12.2022 SWR Fernsehen Deutsche Online-Premiere Di 06.12.2022 ARD Mediathek 32. Canna-Business, „Gras“ wird legal – wer macht das große Geld?
Staffel 9, Folge 2In Deutschland könnte 2024 der erste legale Joint über die Ladentheke gehen. Gras-Liebhaber:innen hoffen, dass Deutschland eine globale Legalisierungswelle anstößt. Start-ups, Pharmakonzerne, Rapper:innen sowie Brauereien sind aktiv. Von den 18- bis 25-Jährigen in Deutschland hat jede:r Zweite schon mal Cannabis konsumiert. Nach Nikotin und Alkohol soll eine dritte Volksdroge legal werden. Wird es ein Markt dominiert von internationalen Konzernen und dem ständigen Streben nach Wachstum? In Sachsen produziert eine Firma medizinisches Cannabis. In Berlin, mit einer Produktionsanlage im Rhein-Main-Gebiet, bereitet sich der Konzern Sanity Group vor, 37 Millionen Euro Investoren-Gelder wurden gesammelt. Angeführt vom CDU-Mann Finn Hänsel entsteht Europas größter Cannabis-Konzern. Promis wie Mario Götze oder Klaas Heufer-Umlauf sind Investor:innen. Ökonom Justus Haucap beobachtet, welche Blüten der neue Markt treibt. (Text: SWR)Deutsche TV-Premiere Di 17.01.2023 SWR Fernsehen Deutsche Online-Premiere Mi 28.12.2022 ARD Mediathek 33. Das brutale Geschäft der Holzmafia
Staffel 9, Folge 3 (45 Min.)Waldpatrouille im Naturschutzgebiet Prey Lang in Kambodscha.Bild: Radio Bremen/Johannes Musial/Johannes MusialIllegaler Holzhandel ist ein Milliardengeschäft. Hohe Renditen und geringer Verfolgungsdruck ziehen die organisierte Kriminalität magisch an. Allein im vergangenen Jahr gab es in Europa für 120 Millionen Tonnen Holz keinen Herkunftsnachweis. Gleichzeitig ist Entwaldung eine der größten Ursachen für das Klimaproblem mit dem Treibhausgas CO2. „Rabiat“-Reporter Johannes Musial begibt sich in „Rabiat: Das brutale Geschäft der Holzmafia“ auf eine riskante Recherche in Kambodscha, Rumänien, Frankreich, Österreich und Deutschland – zweimal kommt Musial gerade noch mit heiler Haut davon.
In Rumänien steht einer der letzten und größten Urwälder Europas. Schätzungsweise die Hälfte der Bäume im Land wird illegal abgeholzt. Einer der wichtigsten Abnehmer für das Holz: Möbelhäuser und Baumärkte in Deutschland. Johannes Musial begleitet die Umweltschützer der Organisation „Agent Green“, die gegen die rumänische Holzmafia kämpfen. Gegen alle, die am illegalen Holz verdienen: Holzfäller, Händler, korrupte Beamte. „Agent Green“-Gründer Gabriel Paun wurde 2015 fast totgeschlagen, als er Hinweisen auf illegale Abholzung nachging.
Mindestens sechs Förster wurden in den letzten zehn Jahren in Rumänien umgebracht. Als der „Rabiat“-Autor Johannes Musial mit den Umweltschützern auf illegale Fällarbeiten stößt, müssen sie vor wütenden Holzfällern aus dem Wald flüchten. Eigentlich sollten Politik und Polizei die einzigartigen rumänischen Wälder schützen, doch Korruption ist weit verbreitet. Die Holzmafia besticht Beamte, Politiker, Polizisten. Die Europäischen Union verwarnte Rumänien bereits 2020, weil es seine Wälder nicht ausreichend schützt.
Konsequenzen hatte das bisher nicht. In Deutschland nimmt der Reporter die Spur des illegalen Holzes auf, gemeinsam mit Johannes Zahnen vom WWF. Er gilt als „der“ Holzdetektiv. Seit 20 Jahren schon sucht er auf dem deutschen Markt nach Holz mit fragwürdigem Ursprung. Gemeinsam gehen sie in Möbelhäuser, kaufen verdächtige Holzprodukte und schicken sie ins Labor. Gibt es Hinweise auf illegales Holz? Bei Interpol in Lyon trifft Johannes Musial den Ermittler Sasa Braun. Er ist zuständig für Umweltkriminalität bei der internationalen Polizeibehörde.
Interpol schätzt den Markt für illegales Holz auf bis zu 152 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Umweltkriminalität sei der drittgrößte Kriminalitätsbereich weltweit, gleich nach Drogenhandel und Produktfälschung. Und: Im illegalen Holzhandel mische die organisierte Kriminalität mit. Es gehe auch um Menschenhandel, Waffenhandel, sogar Terrorismus. In Kambodscha sind ein Drittel der Wälder in den letzten 20 Jahren verschwunden. Die Holzmafia ist mächtig hier, soll Verbindungen in Regierungskreise haben.
Offen darüber reden will deshalb kaum jemand. Marcus Hardtke tut es. Vor 30 Jahren kam der deutsche Umweltschützer nach Kambodscha. Seither legt er sich mit der Holzmafia an. Wie die arbeitet, erlebt Johannes Musial hautnah. Er fährt in den Wald Prey Lang. Es ist das größte Naturschutzgebiet Kambodschas, trotzdem verschwinden die Bäume mit unglaublicher Geschwindigkeit. Eine Gruppe Männer geht dort regelmäßig auf Patrouille, um die Holzfäller zu finden, die den Wald rund um ihr Dorf abholzen.
Als sie sie gefunden haben, wird der „Rabiat“-Reporter wieder aus dem Wald flüchten müssen. Aber er hat eine Holzprobe der gefällten Bäume mitgenommen. Denn das Holz soll in Europa landen. Um mehr herauszufinden, fährt er mit der Probe zum Thünen-Insitut für Holzforschung in Hamburg, das Holz aus der ganzen Welt prüft. Antworten auf das Problem mit illegalem Holz sucht der Film auch bei Holzunternehmen und Politik. Von den Holzmarktführern will nur HS Timber aus Österreich sprechen. Die Firma hat sechs Standorte in Rumänien.
Nach Skandalen in der Vergangenheit wirbt sie jetzt mit Nachhaltigkeit und einem System, das illegales Holz identifizieren soll. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte sagt, sie könnten illegales Holz zu 99,9 Prozent ausschließen. Kann das sein? Und was machen eigentlich die Aufsichtsbehörden? Kritiker sagen, es gäbe zu wenig Kontrollen, zu geringe Strafen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist zuständig für Holzimporte. Auf Anfrage heißt es, illegal geschlagenes Holz habe die Anstalt noch nie gefunden. „Rabiat“-Reporter Johannes Musial fragt deshalb persönlich im Bundeslandwirtschaftsministerium (BMLE) nach, dem die BLE untersteht. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 17.07.2023 Das Erste 34. Ackern oder Aufgeben – Bauernhöfe vor dem Aus?
Staffel 9, Folge 4 (45 Min.)Schweinebauer Simon Donhauser steht kurz vor dem Aus. Sein frisch renovierter Stall entspricht plötzlich nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.Bild: SWRKnöcheltief in der Gülle stehen, bis in die Nacht ackern und trotzdem am Existenzminimum leben. Das ist die Jobbeschreibung vieler Landwirte, vor allem in den kleinen Familienbetrieben. Kein Wunder, dass sich viele junge Bäuerinnen und Bauern immer öfter die Frage stellen: Warum soll ich einen Job machen, der mich zur Verzweiflung treibt? Reporterin Elisa Luzius erlebt täglich, wie ihr Bruder Ansgar auf dem Bauernhof der Familie schuftet und wenig Zeit und wenig Geld für seine Familie bleiben. Neben den Milchkühen hat er mit Legehennen einen neuen Betriebszweig aufgebaut. Noch führt er den Betrieb mit Tante und Onkel zusammen. Aber in diesem Frühjahr muss er die Entscheidung seines Lebens treffen: Wird er die Hofnachfolge übernehmen? Schweinebauer Simon Donhauser aus der Oberpfalz hat den Betrieb seiner Familie bereits übernommen.
Ihn drücken die Schulden für den Umbau des Stalls. Eigentlich müsste er hier weiter investieren – für die Schweinezucht gelten bald neue gesetzliche Regelungen. Nun steht der junge Familienvater vor der bangen Frage, welche Zukunft der Betrieb überhaupt noch hat. Es ist ein Hamsterrad aus Überlastung und Schulden, das manchmal tragisch endet – im Suizid. Wie im Fall von Niklas’ Vater. Wie konnte es so weit kommen? Und warum hat Niklas dennoch den Entschluss gefasst, den Familienbetrieb weiterzuführen? (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 31.07.2023 Das Erste 35. Scheißjob Lehrer?
Staffel 9, Folge 5 (45 Min.)Nora Oehmichen, Gymnasiallehrerin aus Ludwigsburg: „Die Schule ist ein undemokratischer Ort.“Bild: Radio Bremen/Claudia EuenKomfortable Verbeamtung, stattliches Gehalt, jede Menge Ferien und fast immer ab mittags frei, zudem eine Respektsperson im Ort – Lehrersein war mal nah am Traumjob. Das ist lange vorbei. Immer mehr Lehrer und Lehrerinnen schmeißen reihenweise hin und Nachwuchs an den Unis ist kaum in Sicht. Offiziell fehlen 30.000 Lehrkräfte bis 2030, Bildungsforscher gehen sogar von bis zu 150.000 aus. Wie konnte das passieren? „Rabiat“-Reporterin Claudia Euen stellt die Titelfrage: „Rabiat: Scheißjob Lehrer?“. Nora Oehmichen unterrichtet seit 17 Jahren Geschichte, Französisch und Ethik.
Doch die Ludwigsburger Gymnasiallehrerin hadert mit der Schule. Obwohl ihre eigenen Kinder mittlerweile groß sind, arbeitet sie weiter in Teilzeit. Lärm, übervolle Klassenzimmer, ständig Zusatzaufgaben und dauernd Vertretungsunterricht stressen zu sehr. Und: Schule, wie sie heute funktioniert, ist für sie nicht mehr zeitgemäß: Das strenge Bewertungssystem, veraltete Lehrpläne und der fehlende Blick auf die Kinderseele haben sie mürbe gemacht. „Ich muss eine bestimmte Anzahl von Klassenarbeiten schreiben und die müssen für alle gleich sein.
Das frustriert mich“, sagt Nora. Sie engagiert sich bei den „Teachers for Future“, kämpft für eine Reform im Bildungswesen und überlegt, ihren Job ganz hinzuschmeißen. Julia Hehl ist diesen Schritt gerade gegangen. Die 31-Jährige hat in München sechs Jahre an öffentlichen und privaten Gymnasien gearbeitet, 9,5 Stunden pro Tag in der Schule verbracht, am Wochenende die Klassenarbeiten korrigiert und am Ende keinen Ausweg mehr gesehen: „Man hetzt von Klasse zu Klasse und kann das gar nicht so erfüllen, wie man es erfüllen möchte“, sagt Julia.
Was ihr auch nicht gefiel: keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten. Besserung ist nicht in Sicht. An den Unis sinkt die Zahl der Lehramtsstudierenden. Lena Busch hat nach fünf Semestern ihr Studium in Halle erstmal auf Eis gelegt. „Zu wenig Didaktik und Pädagogik, zu viel Theorie“, sagt die Studentin und fühlt sich damit nicht auf ihr Berufsfeld „Grundschule“ vorbereitet. Sie ist nicht die einzige, die an einem starren, undurchlässigen Bildungssystem verzweifelt.
Fidaa Alsilek floh aus Syrien nach Deutschland. Der studierte Englischlehrer kämpfte jahrelang um seine Anerkennung, bis er in Stendal in Sachsen-Anhalt eine Art Lehrer zweiter Klasse werden durfte. Dabei ist jede fehlende Lehrkraft ein Desaster. Ca. 30.000 von ihnen fehlen offiziell bis 2030, manche Bildungsforscher gehen von bis zu 150.000 fehlenden Lehrkräften aus. Die Bildungskrise kam mit Ansage. Eine vorhersehbare Pensionierungswelle trifft auf steigende Geburten-und Zuwanderungszahlen.
Alles lange bekannt, doch gegengesteuert wurde kaum. Nun ist überall Alarm: in den Schulen, weil viel zu viel Unterricht ausfällt und die Leistungen sinken und in den Elternhäusern, weil die Angst ausbricht. „Rabiat“-Reporterin Claudia Euen hat selbst zwei schulpflichtige Kinder und fragt sich angesichts der dramatischen Stundenausfälle, wie sie ihren Abschluss eigentlich schaffen sollen. „Rabiat: Scheißjob Lehrer?“ unternimmt eine ehrliche, ernüchternde Bestandsaufnahme eines einstmals ehrenwerten Berufs, den zu wählen man aktuell schwer empfehlen kann. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 14.08.2023 Das Erste 36. Car-Porn – Im Land der Poser und Tuner
Staffel 9, Folge 6 (45 Min.)Präsenz zeigen in Neukölln: Die Rapper Chapo und Bangs auf einer Spritztour über die Sonnenallee.Bild: SWR/Jakob GrothNicht zu übersehen und zu überhören: Gewaltige PS-Monster donnern jedes Wochenende durch die Innenstädte. Am Steuer der Sportwagen sitzen oft junge Männer unter 30. Vielen geht es um Aufmerksamkeit, Aufstieg und Anerkennung. Für hippe Radfahrer:innen und klimabewusste Großstädter:innen kann eine Reise durch das Land der Poser, Schrauber und Tuner eine verstörende Realität sein. Deutschland ist Autoland: Mit dem „Car-Freitag“ starteten am Osterwochenende PS-Fans ihre Saison. Jedes Jahr versammeln sich am Nürburgring Tausende Tuner. Dort haben sie Freiraum für ihre Autoleidenschaft. Mit knallendem Auspuff sind viele Autos allerdings auch in den Innenstädten unterwegs – und nerven die Anwohner:innen.
„Wir unterscheiden zwischen Rasern, Posern und Tunern. Wobei die Polizei mit legalem Tuning völlig einverstanden ist“, sagt Jürgen Berg, dessen Einheit auf den Kölner Straßen unterwegs ist. Einige Poser sagen ehrlich, dass für sie das Auto ein Statussymbol ist. Dabei spielt auch die soziale Herkunft eine Rolle. „Das dicke Auto zeigt, dass du es geschafft hast rauszukommen“ – so bewertet es der Neuköllner Rapper Bangs. Doch statt Anerkennung ernten junge Männer in teuren Schlitten oft noch mehr Ablehnung. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 28.08.2023 Das Erste 37. Deutschland schiebt ab
Staffel 9, Folge 7 (45 Min.)Abschiebung – darüber diskutiert Deutschland immer wieder und immer heftiger. Vor allem, wenn es um Straftäter geht. 300.000 Menschen in Deutschland sind ausreisepflichtig, 50.000 ohne Duldung. Aber nur ein Drittel der Abschiebungen gelingt. 13.000 waren es im vergangenen Jahr. Kaum ein Thema ist gesellschaftspolitisch so aufgeladen. Oft sind die Meinungen polarisiert: „Kriminelle Ausländer sofort abschieben“ oder „Abschiebung ist Rassismus“. Aber wie funktioniert das System tatsächlich? Funktioniert es überhaupt? Und zu welchem Preis? Wen trifft es und wo landen diese Menschen? „Rabiat“-Reporter Christoph Kürbel beschäftigt sich seit langem mit Flucht und Flüchtenden.
Jetzt blickt er in die Gegenrichtung. Kein Mensch verlässt seine Heimat freiwillig. Und Geflüchtete kehren in der Regel auch nicht freiwillig zurück. Kürbel will das System Abschiebung verstehen und blickt ins Innere. Seine Recherche führt ihn an alle Stationen des komplexen Verfahrens, vom Erstantrag im Berliner Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bis zur Endstation Irak, wo die Flucht oder der Traum von einem neuen Leben endet.
Dabei lernt er Vollstreckende und Betroffene kennen. Im BAMF erlebt Christoph Kürbel die Erstanhörung eines Geflüchteten unmittelbar mit. Bei Daniel Rauscher, einem deutschen Beamten wie er im Buche steht. Er weiß, dass er Menschen vor sich hat, die als Bittsteller kommen und über deren Zukunft in Deutschland er allein entscheidet. Er will alles richtigmachen. Christoph Kürbel trifft den Rapper Sugar MMFK.
Er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Dennoch wäre er beinahe abgeschoben worden, wenn seine starke Fangemeinde das nicht in letzter Sekunde verhindert hätte. Von ihm lernt der „Rabiat“-Reporter, was es auch bedeuten kann, deutsch zu sein. „Laut Papier bin ich nicht deutsch, aber laut meinem Empfinden zu einhundert Prozent“, sagt Sugar MMFK. Deutsch-Sein als Gefühl und gelebte Realität, die aber in den Akten auch nach über 30 Jahren nicht Fakt sind. Der Rapper galt als krimineller Ausländer und geriet so in das System Abschiebung.
Bremens Innensenator Ulrich Mäurer konzentriert sich auf die Abschiebung von Straftätern, denn hier herrscht politischer Konsens. Mäurer schildert offen die begrenzten Erfolge sowie den enormen Aufwand. Für ihn ist das ausländerrechtliche Vorgehen gegen Straftäter aber alternativlos, auch wenn eine Abschiebung bis zu 20.000 Euro kostet. „Wenn man die Bevölkerung überfordert, und das ist der Fall, wenn man nicht gegen Straftäter vorgeht, dann kippt das Ganze,“ so der langjährige Innenpolitiker.
Das fördere auch rechtspopulistische Tendenzen. Die Betroffenen wehren sich. Sultana Sediqi schildert ihre Flucht aus Afghanistan. Jetzt kämpft sie gegen das System der Abschiebung. Sie protestiert am Rande einer Tagung der Innenministerkonferenz gemeinsam mit anderen von Abschiebung Betroffenen vor dem Innenministerium, wo die Innenminister der Länder schärfere Regelungen und mehr Abschiebungen fordern. Für die konkrete Umsetzung zuständig ist Anna (Name geändert).
Sie ist Leiterin einer zentralen Ausländerbehörde. Aus Angst um ihren Job will sie anonym bleiben, denn sie liefert Einblicke ins Innere des Abschiebeapparats und welche Missstände sie im Verfahren und bei Kollegen beobachtet. Im Abschiebegefängnis am Flughafen München kann „Rabiat“-Reporter Kürbel die letzte Station vor der Rückreise filmen und Leiter Axel Ströhlein interviewen. Seine nüchterne Sicht auf den Prozess unterstreicht die kühle Korrektheit an einem Ort, an dem für viele Geflüchtete der Traum vom besseren Leben endet.
Christoph Kürbel steht in einer Zelle, in der kurze Zeit später Mohammed untergebracht sein könnte. Christoph Kürbel erreicht Mohammed telefonisch. Am nächsten Tag soll sein Abschiebeflug gehen und er sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Sprache gelernt, Job in Aussicht, keine Straftaten – dennoch soll er plötzlich weg, weil seine Duldung abgelaufen ist. Christoph Kürbel fliegt selbst in den Irak und trifft Menschen, die zurückgeführt wurden.
Abdullah lebt auf einer Baustelle in Sulaymaniyah, im kurdischen Teil des Irak. Er hat sich hoch verschuldet, um in Europa sein Glück zu finden. Sein Weg über die Belarus-Route führt ihn nach Sachsen und von dort direkt in die Abschiebehaft. Nach 22 Tagen endet Abdullahs Aufenthalt in Deutschland. Darwish ist dagegen freiwillig in den Irak zurückgekehrt, mit einem Rückführungsprogramm des BAMF. Der Jeside ist wegen seiner kranken Mutter zurückgekehrt, seine Frau, Kinder und Enkel befinden sich im deutschen Asylverfahren.
Die „Rabiat“-Reportage zeigt, was aus der Hoffnung auf einen Neuanfang in der Heimat geworden ist. Die Rückführung ist geglückt, auch wenn Darwish weiter in Armut lebt. Er bleibt. Im Laufe seiner Recherche lernt Christoph Kürbel viel über die Handlungszwänge und Nöte der Beteiligten. Er findet heraus, warum viele Abschiebungen scheitern, wie diese Probleme gelöst werden und was das Ganze mit den Menschen macht, mit den Vollstreckern und mit den Betroffenen. Die laufende Debatte ist plakativ, aber die Wahrheit hinter dem System Abschiebung ist weit komplizierter. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 04.09.2023 Das Erste 38. Geplatzte Träume im Profisport – Verlieren verboten!
Staffel 9, Folge 8 (45 Min.)Mathis und sein privater Torwarttrainer Thorsten Albustin beim Training.Bild: Radio BremenIm Spitzensport gilt das brutale Prinzip „the winner takes it all“ – in anderen Worten „verlieren verboten!“ Wie groß ist die Gefahr für auf Sieg getrimmte Top-Athleten, mental abzustürzen, wenn der Traum vom Spitzensport wie eine Seifenblase zerplatzt? Wo bleiben die vielen aussortierten Talente und Verlierer, wenn es allein in Deutschland über 90.000 Profisportler gibt? „Rabiat“-Autorin Lena Oldach spricht mit denen, die für den Sport alles geben und bisweilen gewonnen, aber beim Leben für den Sport auch viel verloren haben.
Tausende Talente träumen im Fußball davon, mit Kicken Geld zu verdienen. Aber selbst von den Talenten aus den Kaderschmieden der Klubs schaffen es nur zwei Prozent, sich als Profi zu etablieren. Der 12-jährige Nachwuchstorwart Mathis erzählt davon, wie ihn der Bundesligist BVB gerade aussortiert hat. Sein Privat-Coach Thorsten Albustin hatte sich den großen Traum Bundesliga erfüllt. Aber nur kurz: Erst wurde Albustin als Elfmeterheld gefeiert, dann war er nach einem Patzer plötzlich raus. Karriereende mit Mitte Zwanzig. „Das war hart!“, sagt er noch heute, Jahre später sichtlich mitgenommen.
Erst entdeckt, dann aussortiert. Das kann den Jungs von der U17-Nationalmannschaft auch noch passieren. Auf den Rängen bei einem Turnier an der Algarve beobachten Scouts aller europäischen Top-Teams den Nachwuchs. Einer von ihnen ist Pablo Thiam, Ex-Fußballprofi und zu dem Zeitpunkt Leiter der Fußballakademie von Hertha BSC. Er lässt sich in die Karten blicken, wie hart und hochselektiv das große Geschäft mit dem Fußball ist, und sagt: „Viele geben alles und schaffen es trotzdem nicht.“ Talent plus Fleiß gleich Erfolg – so einfach ist das nicht.
Siebenkämpferin Louisa Grauvogel hatte es geschafft. Sie war international erfolgreich auf Olympiakurs. Doch dann musste sie die Reißleine ziehen. Sie war körperlich und mental ausgelaugt und kurz vor einem Burnout nicht mehr bereit, für die Chance auf einen Sieg alles zu riskieren. Deshalb ist sie schweren Herzens ausgestiegen – gegen den Willen derer, die wollten, dass sie weitermacht. Jetzt ist ihre große Herausforderung, das selbstbestimmte Leben jenseits von Trainingsplänen und Wettbewerben zu lernen.
Emma Malewski ist Turnerin und lebt seit sechs Jahren für ihren Traum von Olympia im Internat in Chemnitz, weit entfernt von ihrer Familie in Hamburg. Sie ist bereit, alles andere hintanzustellen. Freiräume kennt die 18-Jährige, die zusätzlich zur Schule 30 Stunden in der Woche trainiert, nicht. Und Scheu davor, Schmerzen zu ertragen, hat sie auch nicht: „Jede Turnerin hat irgendwas, was ihr weh tut! Immer!“ Opfer zu bringen für den Titel, findet sie in Ordnung. Aber sie hat sich nie selbst als Opfer eines Systems mit großem Machtgefälle und harten Trainingsmethoden gesehen.
Emma hofft auf Olympia in Paris 2024. Und dass sie nicht irgendwann bereut, dass sie noch nie richtig auf Klassenfahrt oder im Sommerurlaub war oder andere Dinge getan hat, die Teenies normalerweise machen. „Rabiat“-Autorin Lena Oldach ist selbst sportaffin. Sie hat Sportwissenschaften studiert und kehrt in diesem Film auch an ihre Trainingsstätte und zu ihrem Trainer zurück. Nach allem, was sie über das Leben der Profi-Sportler- und Sportlerinnen gelernt hat, ist sie froh, dass ihr Talent für große Träume zu klein war. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 25.09.2023 Das Erste 39. Gottlos – wer hängt noch am Kreuz?
Staffel 9, Folge 9 (45 Min.)Auf der Synode in Frankfurt im April 2023 soll entschieden werden, was nun tatsächlich mit der Schule passiert, und ob die Eltern und Schüler mit ihrem Protest gegen die Schließung Erfolg haben. Die Evangelische Kirche Hessen-Nassau will ihren Haushalt bis 2030 um 140 Millionen Euro schrumpfen. Auf der Synode wird debattiert, wo und wie eingespart werden soll.Bild: ZDF und Radio Bremen/Dennis Weber.Reporterin Katja Döhne besucht Orte, an denen die schleichende Veränderung einer Republik, die sich vom konfessionellen Glauben abwendet, hautnah spürbar ist. (Text: ARD Mediathek)Deutsche TV-Premiere Mi 15.05.2024 3sat Deutsche Online-Premiere Mo 09.10.2023 ARD Mediathek 40. Die perfekte Hochzeit – Tradition, Geschäft und große Gefühle
Staffel 9, Folge 10 (45 Min.)Der Junggesellenabschied darf vor einer Hochzeit nicht fehlen. In einer Karaoke Bar in Hamburg beginnt der Abend. Die Reeperbahn ist in Deutschland eines der beliebtesten Ziele für einen „JGA“.Bild: SWRWenn zwei Menschen heiraten, dann steht ein Heer von Dienstleistern bereit für die perfekte Inszenierung großer Gefühle. Und alle müssen mitmachen: Brautleute, die Trauzeugen, Standesbeamte, Pfarrer oder Pfarrerin – und natürlich die Hochzeitsgesellschaft. Zwischen Junggesell(inn)enabschied und Ja-Wort, zwischen Hochzeitsmesse und Vorbereitungswahnsinn fragt sich „Rabiat“-Autor Manuel Möglich: Was macht ihn aus, den schönsten Tag im Leben? Es soll ein Fest werden, an das sich die Brautleute ihr Leben lang erinnern. Und alle, die dabei gewesen sind, auch. Die Hochzeit als Großevent, das nicht selten über Jahre hinweg vorbereitet wird.
Und zu bedenken gibt es so einiges: „Mein Vater hat ein Jahr vor der Scheidung einen Ehevertrag aufgesetzt und der war zu seinen Gunsten“, erzählt Josua Frank. Er und seine Freundin haben einen Termin beim Anwalt und besprechen einen Ehevertrag. Das junge Paar wird bald heiraten und falls das Worst-Case-Szenario Scheidung irgendwann eintreten sollte, wollen sie keinen Rosenkrieg ausfechten. 000 Ehen wurden 2022 in Deutschland geschlossen. Dabei gehören Heiraten und Kirche für viele immer noch eng zusammen – trotz schwindender Religiosität.
Die Kirchen reagieren darauf. Etwa in der evangelischen Christuskirche in München, mit der Aktion „Einfach heiraten“. Hier lassen sich an einem Tag 56 Paare nacheinander segnen. Kritik an der Aktion bleibt aus den eigenen Reihen nicht aus, die Ehe werde im Eilverfahren verramscht und der Segen billig vermarktet, so der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern.: Ja und für immer! Was macht ihn aus, den schönsten Tag im Leben? Eine „Rabiat“-Reportage zwischen Business und Romantik, zwischen großen Gefühlen und großem Geschäft. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo 30.10.2023 Das Erste Deutsche Online-Premiere Mo 23.10.2023 ARD Mediathek Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 18.09.202341. Ich lass dich gehen – Wenn die Eltern sterben
Staffel 9, Folge 11 (45 Min.)Kosta, 40 Jahre alt, sein Vater ist am Vortag verstorben.Bild: SWR/sendefähig GmbH / SWR Presse/BildkommunikationWir alle wissen, dass unsere Eltern irgendwann sterben. So richtig wahrhaben wollen wir es nicht. Und doch ist diese Konfrontation mit dem Tod unausweichlich. Kann man sich darauf vorbereiten? Wie ist es, die Eltern in den Tod zu begleiten? Und wie ist es, wenn sie gestorben sind? Ein sehr persönlicher Film der Rabiat-Reporterin Lea Semen über Tod und Abschied nehmen. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Fr 24.11.2023 SWR Deutsche Online-Premiere Mo 06.11.2023 ARD Mediathek
zurück
Erinnerungs-Service per
E-Mail