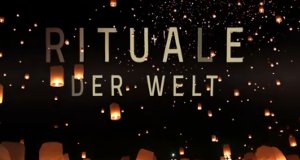Staffel 1, Folge 1–15
Staffel 1 von „Rituale der Welt“ startete am 27.01.2020 auf arte.tv und am 03.02.2020 bei arte.
1. Der Tanz mit dem Feuer in Papua-Neuguinea
Staffel 1, Folge 1 (30 Min.)Anne-Sylvie Malbrancke kennt sich in Papua-Neuguinea bereits gut aus: Sie lebte 18 Monate lang bei zwei verschiedenen indigenen Gruppen auf der Hauptinsel des Landes. Nun trifft sie zum ersten Mal den Volksstamm der Baining. Paul hat sie eingeladen, einem Feuertanz beizuwohnen, der diesmal im Rahmen einer Trauerzeremonie aufgeführt wird. Die Vorbereitungen für das Ritual erstrecken sich über drei Tage. Paul nimmt Anne-Sylvie und einige Männer der Dorfgemeinschaft mit in den Wald, um Material für die Herstellung der großen Masken zu besorgen.
Das Tuch, das sogenannte Tapa, für ihre Masken gewinnen die Männer aus Papiermaulbeerbäumen. Der Rindenbast muss dafür zwei Stunden nach einer altüberlieferten Methode geschlagen werden. Die Masken stellen die Waldgeister dar, welche ihre Stammesvorfahren in den Höhlen des Dschungels gesehen haben sollen. Robert, ein junger Mann aus der Baining-Gemeinde, darf erstmals dabei sein, wenn die Männer die Masken herstellen. Er ist 17 Jahre alt und wurde von den anderen als stark genug befunden, um den Geistern des Waldes standzuhalten.
Und dann kommt das aufregendste: Die Männer müssen noch eine Pythonschlange fangen, die Teil der Zeremonie werden wird. Bei Einbruch der Dunkelheit wird im Dorf ein großes Feuer entfacht. Die Namen der Verstorbenen werden genannt und Körbe mit Erinnerungsstücken an die Flammen übergeben. Es ist ein emotionaler Moment. In diesem Augenblick kommen auch die maskierten Männer und tanzen ums Feuer. Sie springen in die rotglühende Asche, um zu beweisen, dass sie mächtiger sind als die Flammen und damit stärker als die Natur. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mo 03.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Mo 27.01.2020 arte.tv 2. Camargue – Wallfahrt der Hoffnung
Staffel 1, Folge 2 (30 Min.)Jedes Jahr am 24. Mai treffen sich Sinti und Roma aus ganz Europa in der südfranzösischen Kleinstadt Saintes-Maries-de-la-Mer, um ein großes Festritual zu Ehren ihrer dunkelhäutigen Schutzheiligen Sara zu veranstalten. Die Wallfahrt nach Saintes-Maries-de-la-Mer ist das wichtigste religiöse Ereignis, der spirituelle und gesellschaftliche Höhepunkt für die Gemeinschaft der spanisch- und französischstämmigen Sinti und Roma. Sara war die Dienerin zweier von den Römern verfolgter Jüngerinnen Jesu: Maria Salome und Maria Jakobäa. Sie soll die beiden auf einer Barke von Palästina bis zu dem kleinen Dorf in der Camargue geleitet haben, das heute nach diesen beiden Mariengestalten benannt ist.
Von dort aus sollen sie die Camargue und die Provence christianisiert haben. Die Sinti und Roma erkennen sich in der Gestalt der Schwarzen Sara wieder, denn auch sie wurde verfolgt. Da sie in den Städten und in den anderen Kirchen oft nicht willkommen sind, ziehen die Sinti und Roma als ständig Umherreisende Kraft daraus, Gott auf ihre eigene Weise zu huldigen. So erzeugen und erleben sie zumindest in der Wallfahrtszeit soziale Sichtbarkeit und fühlen sich weniger ausgegrenzt.
Am Tag der Prozession werden die Reliquienschreine mit den Gebeinen der beiden Jüngerinnen vom Obergeschoss der Kirche auf den Altar herabgelassen. Und endlich ist auch der lang ersehnte Augenblick gekommen: In einer feierlichen Prozession wird die Statue der heiligen Sara von der alten Wehrkirche bis zum Meer getragen. Dort wird sie von den Gläubigen mit Meerwasser bespritzt. Mehr als zehntausend Menschen begleiten den Prozessionszug genau zu jener Stelle, an der Sara mit Maria Salome und Maria Jakobäa in ihrer Barke an Land geschwemmt worden sein soll. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Di 04.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Di 28.01.2020 arte.tv 3. Äthiopien – Taufe in luftiger Höhe
Staffel 1, Folge 3 (26 Min.)In Äthiopien wagt sich die Anthroplogin Anne-Sylvie Malbranke hoch hinauf: Das Gheralta-Massiv erhebt sich bis in 3.000 Meter Höhe. Es liegt im Norden des Landes, in der Region Tigray, an der Grenze zu Eritrea. Im Herzen dieser massiven Sandsteinfelsen haben die Christen vor über 1.000 Jahren ihre Kirchen gebaut, um Gott noch näher zu sein. Wie ein Finger zeigt ein langgestreckter Felsen zum Himmel. Hier versteckt sich die Kirche, die am schwersten zugänglich ist: Abuna Yemata. Khasa will in einigen Tagen dort ihre drei Monate alte Tochter Arsiema taufen lassen.
Khasa lebt nach einer Tradition, die auf das Alte Testament und das Gesetz Moses zurückgeht und vorsieht, dass Mädchen exakt 80 Tage nach ihrer Geburt getauft werden. Bei Jungen sind es 40 Tage. Äthiopien wurde im 4. Jahrhundert als erstes afrikanisches Land christianisiert. Die Rituale haben sich seither nur wenig verändert. Am Tag der Taufe verlassen Khasa und ihre Tochter das Dorf und machen sich auf den Weg zur Kirche. Khasa und ihre Familienmitglieder tragen traditionelle weiße Kleidung und legen einen Fußmarsch von über einer Stunde zurück, bevor sie den Berg erreichen.
Bei der Taufe selbst wird der Vater nicht dabei sein. In Äthiopien ist dieses Ritual die Sache der Frauen. Sie sind es, die den beschwerlichen Weg zwischen Himmel und Erde auf sich nehmen, um ihr Kind zur Kirche zu bringen. Am Fuße der Kirche angelangt, muss die junge Mutter zunächst noch eine schwindelerregende Felswand erklimmen – mit bloßen Händen und Füßen krallt sie sich im Fels fest. Der Aufstieg ist angsteinflößend und gefährlich. Die Menschen in Äthiopien nehmen dieses Risiko auf sich, damit ein anderer den Eintritt ins Leben feiern kann. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mi 05.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Mi 29.01.2020 arte.tv 4. Guatemala – Drachen für die Toten
Staffel 1, Folge 4 (26 Min.)Guatemala hat sich aus der Kolonialzeit ein architektonisches, aber auch ein religiöses Vermächtnis bewahrt: Am 1. November wird anlässlich des Feiertags Allerheiligen („Día de Todos los Santos“) der Toten gedacht. Im Bezirk Sacatepéquez geschieht dies auf eine ganz besondere Art: Anstatt ihre Toten zu beweinen, lassen die Einwohner Drachen steigen, um somit eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke begleitet Maria bei ihrer Vorbereitung auf das Volksfest. Maria ist Marktverkäuferin und hofft, heute ihre gesamte Ware loszuwerden, um genügend Geld für das Fest zu verdienen.
Für die Guatemalteken ist Allerheiligen der wichtigste Feiertag des Jahres. Das Ritual hat seinen Ursprung in einer Vermischung von Kulturen: Es findet an einem katholischen Feiertag statt, geht aber auf den Glauben an die Macht der Drachen zurück, der schon lange vor der spanischen Kolonisierung in der Maya-Kultur präsent war. Am Folgetag geht Maria mit ihrer ganzen Familie auf den Friedhof und lässt einen Drachen steigen, um mit ihrer vor einigen Jahren verstorbenen Mutter zu kommunizieren. Mehrere Orchester sorgen in allen Ecken des Friedhofs für fröhliche Jahrmarktsstimmung.
Sämtliche Grabplatten sind mit Orangenblütenblättern bedeckt, deren Duft die Toten anlocken soll. Maria, Alfredo und die übrigen Familienmitglieder versammeln sich am Grab von Marias Mutter. Wie die anderen Teilnehmer singen und tanzen sie, von ihren Toten umgeben, die symbolisch für einige Stunden auf die Erde zurückgekehrt sind. Schließlich kommt der lang erwartete Moment: Alfredo versucht, seinen Riesendrachen zum Steigen zu bringen. So will er ein letztes Mal mit der Seele seiner Großmutter in Verbindung treten, bevor sie an den Ort zurückkehrt, von dem sie gekommen ist. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Do 06.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Do 30.01.2020 arte.tv 5. Indien – Das Fest der Farben
Staffel 1, Folge 5 (26 Min.)Schon im Altertum haben die Menschen in Indien die Tagundnachtgleiche im Frühjahr gefeiert – mit Holi, dem Fest der Farben. In der sehr traditionell geprägten Region des Bundesstaates Uttar Pradesh sind die Holi-Feiern besonders eindrucksvoll. Dabei werfen die Menschen, ganz gleich welcher Kaste sie angehören, allen, denen sie begegnen, Farbpulver ins Gesicht. Die indische Gesellschaft unterliegt einer komplexen hierarchischen Ordnung: dem Kastensystem. Die Brahmanen ganz oben auf der sozialen Leiter üben die „reinen“ Berufe aus, sind Lehrer, Anwalt oder Priester.
Auf der untersten Stufe stehen die Dalits. Ihnen werden traditionell die „unreinen“ Berufe überlassen. Sie arbeiten als Färber, Müllmänner oder Metzger. Bagwan und seine Frau Ludmila sind Dalit. Holi ist ein wichtiges Fest für sie – genau wie für alle anderen Ausgestoßenen der indischen Kastengesellschaft. Dazu gehören auch die Witwen von Vrindavan. „Das Holi-Fest ist etwas Wunderbares. Ich als Dalit bin sehr glücklich, wenn ich gemeinsam mit den Brahmanen feiern kann.
Ganz ohne Diskriminierung“, sagt Bagwan. Anne-Sylvie und Bagwan besuchen einen der größten Tempel der Stadt, wo das Fest gefeiert wird. Hunderte Menschen versammeln sich am Fuße des Altars und lassen sich im Namen Krishnas von Hindupriestern mit Farbpulver und buntem Wasser segnen. Ganz allmählich ändern sich die Verhältnisse in Indien. Erst kürzlich – und erst zum zweiten Mal in der Geschichte – ist ein Dalit zum Staatspräsidenten gewählt worden. Menschen wie Bagwan haben aber noch einen langen Weg vor sich. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 07.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Fr 31.01.2020 arte.tv 6. Amazonien – Vom Kind zum Mann
Staffel 1, Folge 6 (26 Min.)Im Amazonasregenwald in Brasilien trifft die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke Sergio, der seinen Stamm vor 20 Jahren verlassen hat, um in der Stadt zu studieren. Dieses Jahr kehrt er mit seinem zwölfjährigen Sohn Jackson in seine ursprüngliche Gemeinde zurück. Für den Jungen ist es an der Zeit, innerhalb des Sateré-Mawé-Stammes in den Rang der Krieger aufzusteigen. Um das zu schaffen, muss er das Schlimmste über sich ergehen lassen, was der Urwald zu bieten hat: das Tucandeira-Ritual. Dabei wird er seine Hände in gewebte Handschuhe stecken müssen, die mit Hunderten von Tucandeira-Ameisen gespickt sind.
Der Stich dieser Ameisen soll 30 Mal schmerzhafter sein als ein Bienenstich. Bevor das Ritual beginnen kann, gehen Sergio und die anderen Männer des Stammes in den Wald, um die drei Zentimeter großen Riesenameisen einzusammeln. Sie zwängen die Tiere in das Flechtwerk der Handschuhe und achten darauf, dass der Stachel nach innen gerichtet ist. Für das Ritual benebeln die Männer die Ameisen mit Rauch, um ihre Aggressivität zu steigern.
Sobald Jackson die Handschuhe überstreift, werden sie stechen. Jackson weiß, dass er fünf lange Minuten durchhalten muss, ohne seinen Schmerz zu zeigen, um in den Kreis der Männer aufgenommen zu werden. Sergio und die übrigen Mitglieder des Sateré-Mawé-Stammes unterstützen ihn, indem sie singen und tanzen. Den qualvollen Initiationsritus halten die Sateré-Mawé-Indianer für eine gute Vorbereitung, um den Herausforderungen des Lebens standhalten zu können. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mo 10.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Mo 03.02.2020 arte.tv 7. Bolivien – Fäuste für die Pachamama
Staffel 1, Folge 7 (26 Min.)Die Quechua sind ein Ackerbauernvolk im bolivianischen Hochland. Jedes Jahr im Mai versammeln sich Tausende von ihnen in der Ortschaft Macha, etwa 150 Kilometer von der Hauptstadt Sucre entfernt. Hier findet eines der spektakulärsten und härtesten Rituale Lateinamerikas statt: das Tinku. In mehr als 4.000 Meter Höhe trifft die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke die Kallengeras, eine rund 60 Seelen zählende Quechua-Gemeinschaft. Der 34-jährige Landwirt Augustino nimmt dieses Jahr an seinem 15. Tinku teil. Dafür wird er sich einen todesmutigen Kampf mit den Männern der Nachbardörfer liefern.
Das Tinku ist ein Fruchtbarkeitsritual in Form eines heftigen Kampfes. Das vergossene Blut gilt als Nahrung für die Erdgöttin Pachamama, die so für gute Ernten, fruchtbare Ehegattinnen und große Lama-Herden sorgt. Das Ritual ist ein direktes Erbe der Inkas, die vor mehr als 500 Jahren über dieses Gebiet herrschten. Schon damals wurden Zweikämpfe veranstaltet, um das Blut fließen zu lassen und die Göttin Pachamama zu „befruchten“. Dutzende von Dorfgemeinschaften aus allen Ecken von Altiplano kommen zur Eröffnungszeremonie des Tinku herbei.
Alle sind Pachamamas Aufruf gefolgt, haben ihre traditionellen Kostüme angelegt und sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Im Stadtzentrum von Macha drängen sich mehr als 8.000 Menschen zusammen. Sie alle machen vor der Kirche halt, um den Turm mit dem lokalen Bier Chicha zu begießen – ebenfalls als Teil des Fruchtbarkeitskults. Die Gemüter erhitzen sich, als die Kämpfe beginnen. Zwei bis drei Tage lang werden Augustino und die Männer tanzen, singen und trinken bis zum Umfallen – und vor allem kämpfen bis aufs Blut … (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Di 11.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Di 04.02.2020 arte.tv 8. Indien – Vom Mädchen zur Frau
Staffel 1, Folge 8 (26 Min.)In Indien ist die Mehrheit der Ehen arrangiert. Frauen und Männer heiraten nicht einfach, wen sie wollen – die Familie entscheidet. Das Hindi-Wort dafür lautet Shaadi. Die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke begibt sich ins romantische Jaipur in Rajasthan, um der Hochzeit einer 25-jährigen Frau beizuwohnen. Meenal ist eine moderne junge Frau. Sie hat studiert, arbeitet und ist finanziell unabhängig. Und doch möchte sie streng traditionell heiraten. Mit Hilfe einer App fanden ihre Eltern das perfekte Profil ihres zukünftigen Mannes. Vineet erfüllte alle Kriterien. Am wichtigsten war jedoch, dass beide Familien der höchsten Kaste angehören: den Brahmanen.
Meenal hat ihren zukünftigen Ehemann bisher nur zweimal getroffen. In wenigen Tagen wird sie alles aufgeben, um ihm zu folgen. In Indien beinhaltet eine Hochzeitszeremonie zahlreiche Rituale, die es streng einzuhalten gilt, damit die Ehe lange währt. Am Tag vor der Hochzeit treffen sich die Frauen der Familie für das traditionelle Henna. Am Tag der Hochzeit trägt das Brautpaar sehr viel Schmuck – er symbolisiert den künftigen Wohlstand der Familie. Der Bräutigam kommt auf einem Pferd an den Ort der Hochzeitsfeier – eine Tradition, die der gesamten Hochzeitsgesellschaft zeigen soll, dass er ein König ist und seine zukünftige Frau wie eine Königin behandeln wird.
Mit dem traditionellen Tausch der Blumenketten beginnt die Zeremonie. Im engsten Familienkreis wird die Verbindung des Brautpaars von den Göttern gesegnet. Vor dem heiligen Feuer geben sich Meenal und Vineet sieben Versprechen und verbinden sich so für ihre sieben nächsten Leben. Dieses Ritual wird mehrere Stunden dauern. Zu einer Heirat in Indien gehört Freude ebenso wie Trauer, da die Braut ihre Familie verlassen muss. Meenal und Vineet haben nun ein ganzes Leben vor sich, um sich kennen und vielleicht auch lieben zu lernen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mi 12.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Mi 05.02.2020 arte.tv 9. Myanmar – Der Kult der Nat
Staffel 1, Folge 9 (26 Min.)Jedes Jahr reisen Tausende Myanmaren zu einem großen kollektiven Ritual nach Tangbyon. Sie bleiben eine ganze Woche lang in dem 400-Seelen-Dorf und huldigen übernatürlichen Wesen, den sogenannten Nats, in der Hoffnung, dass diese ihre Wünsche erfüllen. Vor Ort trifft die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke die Händlerin Daw Kyar Ma aus Rangun, der größten Stadt und ehemaligen Hauptstadt von Myanmar. Daw Kyar Ma ist Buddhistin, aber wie die Mehrheit der Einheimischen verehrt auch sie Geister namens Nats. Der Nat-Kult existierte im Lande schon lange, bevor der Buddhismus Einzug hielt. Die Nats verkörpern meistens ehemalige birmanische Könige, die auf gewaltsame Weise zu Tode kamen und in den Rang von Geistern erhoben wurden.
Im Volksglauben wird den Nats die Fähigkeit zugeschrieben, Gebete zu erhören. Daw Kyar Ma nimmt seit mehr als 20 Jahren an dieser Zeremonie teil. Dieses Jahr will sie die Nats um die Heilung ihres Mannes bitten, der an der Bauchspeicheldrüse erkrankt ist. Nach 15-stündiger Zugfahrt treffen Daw Kyar Ma und Anne-Sylvie in Tangbyon ein. Dort trifft sich Daw Kyar Mar mit Ko Myint Thu, einem der wichtigsten Medien. Die Mittler zwischen den Nats und den Gläubigen sind meist Männer, Transvestiten oder Homosexuelle. Obwohl Homosexualität in Myanmar unter Strafe steht, darf während der Zeit des großen Rituals jeder, der will, Frauenkleider tragen und sein Anderssein ausleben. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Do 13.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Do 06.02.2020 arte.tv 10. Polynesische Tattoos – Samoa unter der Haut
Staffel 1, Folge 10 (26 Min.)Auf Samoa wohnt Anne-Sylvie Malbrancke einem altüberlieferten Ritual bei: Die rituellen Tätowierungen Samoas haben nur wenig mit den Tattoos gemein, die sich Menschen in Europa stechen lassen. In unserem Kulturkreis sind Tätowierungen ein Zeichen für Individualität. Schmerzen werden dabei auf ein Minimum reduziert. Auf Samoa ist es genau umgekehrt: Hier ist das Tätowieren ein Ritual, das die Zugehörigkeit zu einem Clan zum Ausdruck bringen soll. Die Überwindung extremer Schmerzen ist dabei integraler Bestandteil. Stivi stammt aus Samoa und lebt in den USA.
Dieses Jahr hat er sich dazu entschlossen, das mehrtägige Ritual über sich ergehen zu lassen. Seit zwei Wochen lässt er sich nun schon täglich Tinte unter die Haut stechen und ist völlig erschöpft. Doch er wird die Schmerzen weiter ertragen müssen und noch wichtiger: Er wird den anderen beweisen müssen, dass sie aushaltbar sind. Je stärker der Schmerz, desto näher kommt Stivi dem Status eines „echten“ Mannes und desto eher wird er von der Gemeinschaft als solcher anerkannt. Li’aifava, Stivis Tätowierer, genießt ein hohes Ansehen beim Clan.
Sein Wissen wurde ihm mündlich übermittelt, seine Ausbildung erstreckte sich über viele Jahre. Die Technik zur Herstellung der benötigten Instrumente wie Messer und Hammer ist seit jeher die gleiche geblieben. Der Legende nach wurde die Kunst des Tätowierens den Samoanern von Gottheiten überliefert. Li’aifavas Können wird daher als heilig angesehen. Stivis Angehörige sind gekommen, um ihn zu unterstützen. Nach vier Stunden ist der junge Mann schweißgebadet und scheint den Schmerz kaum mehr ertragen zu können. Doch es steht seine eigene Ehre und die seines Clans auf dem Spiel … (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 14.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Fr 07.02.2020 arte.tv 11. Sevilla – Im Bann der Prozessionen
Staffel 1, Folge 11 (26 Min.)In Sevilla erlebt Anne-Sylvie Malbrancke eines der wichtigsten Buße-Rituale des Christentums: die Semana Santa. Eine Woche vor Ostern wird damit Jesus Christus’ Tod und Auferstehung gefeiert. Von Palmsonntag bis Ostersonntag gibt es zahlreiche Prozessionen. Geleitet werden sie von jeweils einer der 60 christlichen Bruderschaften der Stadt. José ist Teil einer solchen Bruderschaft. Er ist Costalero und wird zusammen mit den anderen Mitgliedern seiner Gemeinschaft einen sogenannten Paso durch die Straßen der Stadt tragen. Dabei handelt es sich um einen gewaltigen Schrein, der über zwei Tonnen wiegt und ein biblisches Motiv abbildet. Einige Stunden bevor das Ritual beginnt, treffen sich die Costaleros von Josés Bruderschaft vor der Kirche ihrer Gemeinde.
Ihr Leiter, Juanma, gibt letzte Anweisungen. Alle stellen sich darauf ein, körperliche Schmerzen zu durchleiden. In wenigen Augenblicken werden sie die Kirche betreten und unter ihrem Paso verschwinden, den sie über fünf Stunden lang tragen müssen. Draußen haben sich bereits Menschenmassen versammelt, um die vorbeiziehenden Pasos anzuschauen und vor den religiösen Szenen, die sie darstellen, zu beten. In den Gesichtern der Menschen sieht man, dass es hier um weit mehr geht als um den Tod Jesu: Es geht um innere Einkehr und sehr viel Freude. Der Frühling wird begrüßt, das Leben wird empfangen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mo 17.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Mo 10.02.2020 arte.tv 12. Peru – Heilendes Wasser
Staffel 1, Folge 12 (26 Min.)In den Anden, an der Grenze zwischen Peru und Ecuador, sollen manche Orte eine Seele haben. Seit über 700 Jahren schöpfen die Schamanen ihre Heilkräfte aus den heiligen Lagunen der Huaringas. Anne-Sylvie Malbrancke trifft Jenny, eine junge Peruanerin, die quer durchs Land gereist ist und einen Großteil ihrer Ersparnisse ausgegeben hat, damit die heiligen Seen sie wieder gesundmachen. Das Ritual, in das sie so große Hoffnungen setzt, wird weit oben in den Bergen abgehalten und von Oscar Herrera angeleitet. Er ist einer der bekanntesten Curanderos der Region und entstammt einer alten Schamanenlinie.
Er wird die Zeremonie führen, Kontakt mit den Kräften der Natur aufnehmen und versuchen, die junge Frau zu heilen. Jedes Jahr empfängt er etwa hundert Menschen wie Jenny. Die Objekte, die er dabei verwendet, kommen aus ganz unterschiedlichen Traditionen. Einige Symbole stammen von den Inkas, andere sind dem Christentum entlehnt. Die Zeremonie dauert eine Nacht. Jenny bekommt zunächst ein halluzinogenes Getränk auf Basis des San-Pedro-Kaktus, um sich zu reinigen. Daraufhin stellt der Schamane ihr Fragen, um den Ursprung ihres Leidens zu verstehen.
Am Morgen des folgenden Tages kommt der wichtigste Teil des Rituals: die allumfassende Reinigung. Sie geschieht im heiligen See auf 3.800 Meter Höhe. Die junge Frau taucht in das sechs Grad Celsius kalte Wasser, um sich von ihren negativen Energien zu befreien. Dem Glauben der Inka zufolge besteht die Natur aus fühlenden Wesen. Schamanen sind in dieser Tradition Weise, Therapeuten und Seher zugleich. Sie sind in der Lage, mit den Kräften der Natur zu kommunizieren, um die Lebenden zu heilen … (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Di 18.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Di 11.02.2020 arte.tv 13. Äthiopien – Sprung ins Erwachsensein
Staffel 1, Folge 13 (26 Min.)Die Gegend am Unterlauf des Omo-Flusses im südlichen Äthiopien liegt so abgeschieden, dass sich hier traditionelle Sitten und Gebräuche erhalten haben. Zu den acht großen Ethnien, die hier leben, gehören die Hamar. Sie leben in provisorischen Hütten, versprengt in der Savanne, und sind ein halbnomadisches Volk, das mit seinen Dörfern weiterzieht, immer dorthin, wo das Gras für die Herden am grünsten ist. Rinder haben einen wichtigen Stellenwert in der traditionellen Lebensweise der Hamar und spielen eine große Rolle bei ihren Riten.
Die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke darf bei einem Initiationsritus dabei sein. Bis jetzt wurde der 20-jährige Wale von seinem Stamm noch als Kind angesehen, doch nun ist er alt genug, um die Bewährungsprobe zu bestehen, die ihn zum Mann macht. Das Ritual, der sogenannte Bullensprung, ist gefährlich: Der junge Mann muss dreimal über die Rücken mehrerer nebeneinanderstehender Rinder laufen, die an den Hörnern festgehalten werden, ohne herunterzufallen. Beim Sprung muss er nackt sein, wie am Tag seiner Geburt. Wenn er scheitert, wird er von den Dorfbewohnern verspottet – und darf nicht heiraten.
Die Hamar-Frauen zeigen sich mit den Männern solidarisch, indem sie sich auspeitschen lassen. Dieser gewaltsame Ritus ist heute im Land verboten; Regierungsvertreter besuchen die ländlichen Gegenden, um die Praxis der rituellen Auspeitschung zu unterbinden. Doch Khaya will ihrem Bruder Wale um jeden Preis ihren Mut beweisen und versteht nicht, warum die Regierung den alten Brauch verbietet. Die Narben auf ihrem Körper sollen den moralischen Bund zwischen Bruder und Schwester besiegeln. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Mi 19.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Mi 12.02.2020 arte.tv 14. Karneval auf Haiti – Die Schatten der Vergangenheit
Staffel 1, Folge 14 (26 Min.)In Jacmel an der Südküste Haitis feiern die Haitianer seit mehr als drei Jahrhunderten einen riesigen Straßenkarneval. Es ist der Karneval der Geister, bei dem mitten im ausgelassenen Treiben der Toten gedacht wird. Ob als schaurige Kreaturen, Teufel oder Diktatoren verkleidet – bei der Parade ziehen die Kostümierten drei Tage lang durch die Hauptstraßen Jacmels. Die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke erlebt den Karneval an der Seite von Rony und Elie. Rony will sich diesmal als Chaloska verkleiden – eine Figur, die an den General Charles Oscar Etienne erinnert, der für den Tod Hunderter politischer Gefangener verantwortlich war.
Beim Karneval von Jacmel ist er bis heute eine der meistdargestellten Personen. Elie will sich als Bossale verkleiden. Körper und Gesicht wird er dafür mit Schlamm und Ruß bedecken, wie es auch bei den Sklaven der Fall war, die von Afrika nach Haiti verschleppt wurden, um auf dem Land zu arbeiten. Der junge Mann ist stolz auf seine Vorfahren. Die Bossales kämpften erfolgreich für ihre Freiheit. Haiti war die erste schwarze Republik, die im Jahr 1804 ihre Unabhängigkeit erreichte. In dem Land, das zu den ärmsten der Welt gehört und in seiner Vergangenheit von Sklaverei, Diktaturen, Naturkatastrophen und Epidemien heimgesucht wurde, sind die Feierlichkeiten unglaublich ausgelassen.
Auf den Karnevalswägen sind Baby Doc und andere Diktatoren des Landes zu sehen, etwa wie sie mit Vater Aids und Erdbebenzombies tanzen. Die Haitianer verschaffen sich Abstand zu ihrer schmerzlichen Vergangenheit, indem sie die Geister der Vergangenheit mit ihren Masken zum Leben erwecken. Der Karneval ist eine Form der Erinnerungsarbeit: Er ermöglicht es den Bewohnern des Landes zurückzublicken und sicherzustellen, dass sich bestimmte Ereignisse nicht wiederholen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Do 20.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Do 13.02.2020 arte.tv 15. Madagaskar – Tanz mit den Toten
Staffel 1, Folge 15 (26 Min.)Im zentralen Hochland von Madagaskar unterhält das Volk der Merina eine einzigartige Verbindung zu seinen Verstorbenen. Von Juli bis September nutzt es die Trockenzeit, um einen traditionellen Ritus zu begehen: die Famadihana. Das Totenwendungsfest ist der wichtigste Ritus im Ahnenkult Madagaskars und die Gelegenheit für ein zweitägiges, ausgelassenes Fest, das die Familien zusammenführt. Zusammen mit Ndriana entdeckt die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke diese alte Tradition. Ndriana exhumiert vier Mitglieder seiner Familie, darunter seinen vor 20 Jahren verstorbenen Vater.
Die Totenwendung wird alle sieben Jahre begangen, manchmal auch öfter, falls in der Zwischenzeit ein Verstorbener seinem Angehörigen im Traum erscheint und ihn um Fürsorge bittet. Um seinen Vater zu ehren, ließ Ndriana ein neues Leichentuch weben. Denn bei den Merina glaubt man, dass sich die Leichentücher nach einer bestimmten Zeit abnutzen, so dass die Toten frieren und neue Kleidung brauchen. Ndriana erwartet in seinem Elternhaus ungefähr 300 Personen. Da Madagaskar zu den ärmsten Ländern der Welt zählt, teilen sich die Familien die Ausgaben – sie betragen etwa zwei Jahresgehälter – und sparen monatelang für die Zeremonie.
Am Tag des Rituals werden die Leichen aus ihrer Gruft geholt und der Familie, den Gästen und der Dorfbevölkerung vorgeführt. Die Nachfahren des Verstorbenen wechseln die Leichentücher und tragen den frisch „eingekleideten“ Leichnam bei Musik, Tanz und Gesang auf ihren Schultern durchs Dorf. So versammelt die Famadihana die Lebenden und feiert den Sieg des Lebens über den Tod. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Fr 21.02.2020 arte Deutsche Online-Premiere Fr 14.02.2020 arte.tv
Erinnerungs-Service per
E-Mail